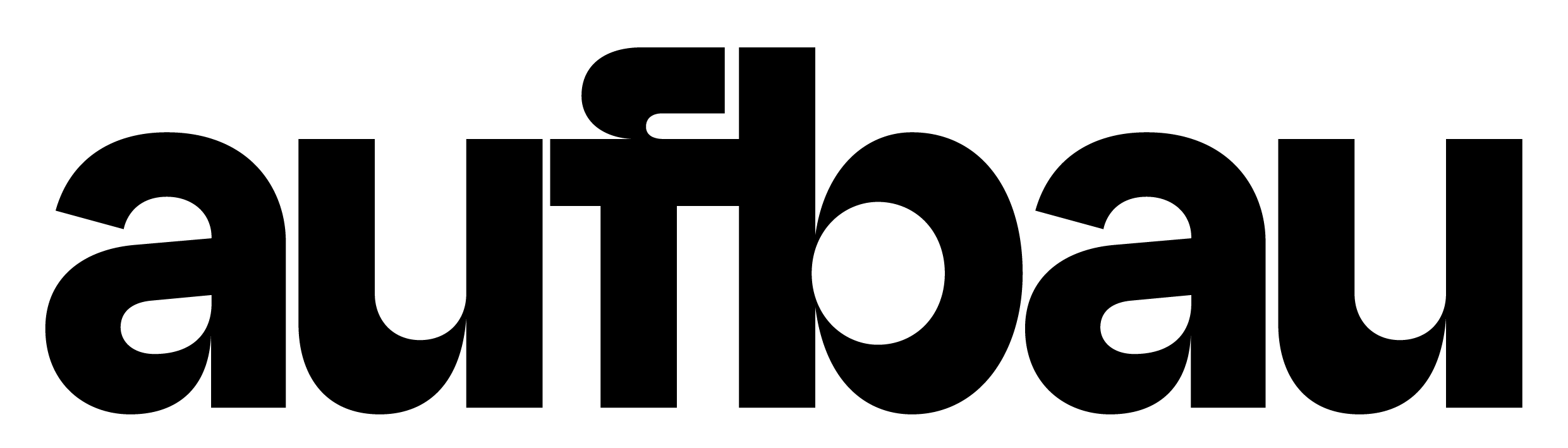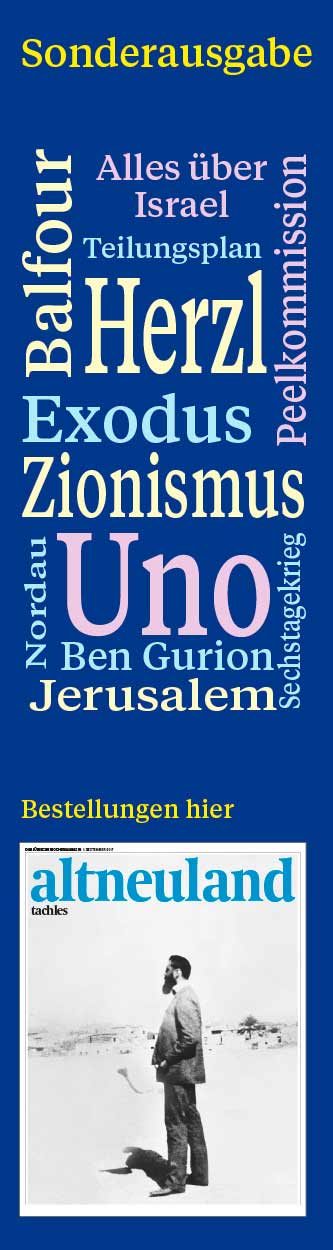Die jüdische Presse mit Tradition plant die Zukunft und verhandelt die Gegenwart.
Als Nazi-Flüchtlinge vor 90 Jahren den aufbau in New York gegründet haben, waren die Wannseekonferenz und Auschwitz noch weit weg – und auch nicht. Die Autorinnen und Autoren Hannah Arendt, Albert Einstein, Stefan Zweig, Thomas Mann und Hunderte anderer hatten die Zeichen der Zeit längst verstanden, im Exil eine neue Heimat gesucht und die alte Sprache behalten. Deutsche Kultur sollte Referenzpunkt bleiben und der aufb au zugleich die Heimat im Exil. Der Rest ist bekannt. Die Zeitschrift vereint bis heute die wichtigsten Stimmen und hat sich immer wieder neu erfunden. Mit dieser Ausgabe erscheint der aufb au im Jubiläumsjahr mit neuem Layout. Verlag und Redaktion freuen sich über den neuen Herausgeber Michel Friedman. Doch gleichsam ist der Anlass für ein erneutes Engagement des aufbau der Bedrohung der liberalen Demokratien an beiden Enden der Transatlantischen Brücke geschuldet. Ohne falsche historische Analogien bemühen zu müssen, spiegelt sichder zunehmende völkische Nationalismus von heute in Albert Einsteins Zeile aus dem amerikanischen Exil von 1947: «Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das gegenwärtige System souveräner Nationen
Barbarei, Krieg und Unmenschlichkeit nach sich ziehen muss und dass nur ein Weltrecht zu einer zivilisierten, friedlichen Menschheit führen wird.»
Der aufbau ist diesem Zielpunkt bis heute treu geblieben und stellt 80 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz mit Bärbel Bas, Wolf Biermann, Ari Folman, Sibylle Berg, Anetta Kahana, Raphael Gross, Thomas Sparr, Alice Brauner, Monica Strauss, Robert Menasse, Andreas Mink und Doug Chandler in dieser Ausgabe die Frage nach Erinnerung, dem fortwährenden Antisemitismus, nach dem Trauma der zweiten Generation, der Zeugenschaft der immer weniger werdenden Überlebenden. Hier hat Redakteur Mink auf einer Reportage in Dallas mit Karl Kuby und Walter Levy zwei Freunde getroff en, die den Vernichtungswillen der Nazis als Kinder und Jugendliche in Deutschland auf eigene Weise erlitten – und ihr Lebenund Wirken als Erwachsene in der neuen Heimat Amerika der Schaff ung von Gemeinschaft gewidmet haben. Der Ohnmacht vieler angesichts der zunehmenden Konspiration gegen die vermeintliche Fremde in der Gesellschaft und allen voran Jüdinnen und Juden, die wieder neu entfachte Relativierung und Leugnung des Holocaust, stellt der aufbau die Antwort entgegen: Demokratie muss erschrieben und herbeidebattiert werden. Offenheit mit Respekt, Pluralität der Stimmen und Würde der Menschen als Ausgangspunkt bleiben das Primat des aufbau. Gerhard Richter setzt all das ins Bild und hat im aufbau exklusiv den Abdruck der Gemäldeserie «Birkenau» kuratiert. Die Arbeiten aus dem Jahre 2014 gehen auf Fotografi en des jüdischen Auschwitz-Häftlings Alberto Errera aus dem Jahr 1944 zurück, die aus dem Vernichtungslager geschmuggelt werden konnten. Sieben Jahre nach Entstehung hat Richter die digital duplizierten Bilder für eine Dauerinstallation an den Bundestag übergeben. Nun findet die Serie «Birkenau» in die einzige Publikation weltweit, die das Lager bereits im Frühjahr 1943 als Ort einer von Nazi-Deutschland an den Juden im gesamten, damals besetzten Europa betriebenen «rasenden Vernichtung» identifiziert hatte. Begleitet von einem täglichen Online-Auft ritt mit der aktuellen politischen Karikatur und einem Podcastprogramm wie etwa dem Format «Echo in die Zukunft» macht sich der aufb au auf in die nächste Dekade und freut sich auf Sie als Leserinnen und Leser.